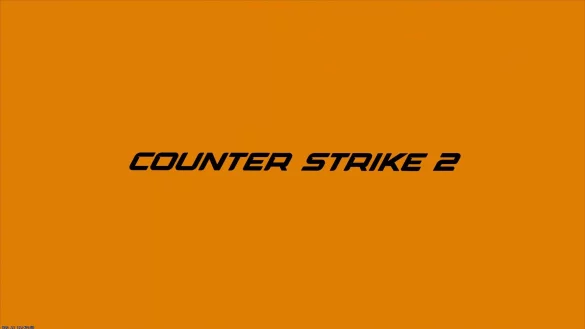Counter-Strike, wir kennen uns seit etwa 20 Jahren. An unsere erste Begegnung kann ich mich, offen gestanden, nicht mehr erinnern. Es war bestimmt auf einer Lan-Party, womöglich im heimischen Keller. Auf diesen Partys kamen und gingen so manche Spiele. Aber dieses Game blieb. Und wenn es nur für eine Partie war: „Counter-Strike“ war auf jeder Lan-Party dabei.
Seitdem hat das Spiel einige Änderungen durchlaufen. Wie eine Schlange, die sich häutet und dabei kontinuierlich wächst, präsentierte sich der Taktik-Shooter von Zeit zu Zeit in neuem Gewand – unter klangvollen Zusatzbezeichnungen wie 1.0, 1.6, Condition-Zero, Source oder zuletzt Global-Offensive. Der Kern blieb dabei immer der selbe.
Nun hat Entwickler Valve „Counter-Strike 2“ veröffentlicht. Und wir klären nicht nur, was dieses Spiel so erfolgreich macht, sondern auch, ob der nominell zweite Teil etwas taugt.
So simpel – und doch so genial

Das Spielprinzip von „Counter-Strike“ ist so simpel wie genial. Im Grunde wurde das alte Kinderspiel Räuber und Gendarme auf den PC übersetzt. Bei „Counter-Strike“ treten zwei Gruppen gegeneinander an. Die Terroristen versuchen, einen Sprengsatz in einem bestimmten Bereich zu legen und diesen bis zur Explosion zu verteidigen. Die Anti-Terroreinheit setzt alles daran, dieses zu verhindern. In einem anderen spielbaren Szenario haben die Terroristen Geiseln genommen, die die Anti-Terroreinheit befreien muss. Eine Partie wird über mehrere Runden gespielt. Am Anfang einer jeden Runde können sich die beteiligten Mitspieler mit Waffen, verschiedenen Granaten oder schusssicheren Westen ausrüsten. Das dafür benötigte Geld verdienen wir uns, indem wir die Bombe legen, eine Geisel befreien – oder eben einen Gegner töten.
Dabei sind nicht unbedingt die Waffen ausschlaggebend dafür, ob wir einen Gegner töten oder nicht. „Counter-Strike“ steht wie so viele (Taktik-)Shooter für Reaktionsgeschwindigkeit, Reflexe und viel Training. Die Spieler und Spielerinnen müssen nicht nur über die Vor- und Nachteile der Waffen Bescheid wissen, sie sollten sich auch auf den unterschiedlichen Karten auskennen, auf denen die Runden stattfinden.
Mit am wichtigsten ist aber die Kommunikation. Das Team muss miteinander sprechen, die Taktik absprechen oder die Position des Gegners mitteilen. Allzu oft habe ich es erlebt, dass Teams Partien verlieren, weil jeder sein Ding durchgezogen hat.
Feindbild Counter-Strike
Das Spiel war in seiner nunmehr langen Geschichte umstritten. Und diese Geschichte ist mit dem Game eng verknüpft. Die Tatsache, dass bei „Counter-Strike“ Spezialeinheiten und Terroristen gegeneinander antreten, gibt dem Spiel ein realitätsnahes Szenario. Menschenähnliche Figuren bekämpfen sich gegenseitig mit Waffen – das rief Anfang der 2000er massive Kritik hervor.
Schnell wurde „Counter-Strike“ als Killerspiel abgestempelt und als Beispiel für Gewalt in Computerspielen angeführt. Zudem erschien der Titel kurz nach dem Amoklauf zweier Schüler an der High-School im US-amerikanischen Littleton, bei dem 13 Menschen getötet wurden und sich die beiden Täter am Ende selbst erschossen. Bereits zu dieser Zeit wurde der Konsum fiktionaler Gewalt in Computerspielen der beiden Täter als ein Auslöser der Tat benannt.
In Deutschland bearbeitete die damalige Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften (heute: Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien) im Jahr 2002 einen Indizierungsantrag für „Counter-Strike“. Dieses Vorhaben und die Debatte um Killerspiele wurde mit einem Schlag brisanter, als ein damals 19-Jähriger an seinem ehemaligen Gymnasium in Erfurt 16 Menschen erschoss und sich danach selbst tötete.
Auch nach Erfurt wurde der Konsum von fiktionaler Gewalt, insbesondere von Ego-Shootern, in einen direkten und kausalen Zusammenhang mit der Ausübung der Tat gebracht. Häufig wurde „Counter-Strike“ in der damaligen Berichterstattung genannt – dabei hatte sich der Täter nachweislich nicht dafür interessiert. Und auch die Gründe für die Tat lagen mitnichten im Konsum fiktionaler Gewalt. Vielmehr war offenbar der Schulverweis, der sich im Nachhinein als nicht rechtmäßig herausstellte, der ausschlaggebende Grund. Denn dadurch hatte der Täter keinen Schulabschluss und kaum berufliche Perspektive. Für den damals 19-Jährigen eine ausweglose Situation – die gleichwohl keine solche Tat rechtfertigt.
„Counter-Strike“ landete damals nicht auf dem Index. Allerdings wurde das Spiel von einem Teil der Öffentlichkeit kritisch beäugt. Wann immer nach Erfurt ein junger Mensch in Deutschland an seiner Schule Amok lief, in Emsdetten (2006) oder Winnenden (2009), war die erneute Diskussion um Killerspiele vorprogrammiert. Viel zu oft habe ich diese Debatten mit den eigenen Eltern geführt. Viel zu oft die vermeintlichen Argumente, dass Killerspiele automatisch aggressives Verhalten fördern und die einzige Erklärung für Amokläufe seien. Eine Sichtweise, die durch bisweilen reißerische, unsachgemäße und verzerrte Medienberichte unterfüttert wurden.
Glücklicherweise scheint das überwunden zu sein. Wissenschaftliche Studien haben mittlerweile festgestellt, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Konsum fiktionaler Gewalt und Amokläufen gibt und dass keine erhöhte Gewaltbereitschaft besteht, wenn Titel wie „Counter-Strike“ gespielt werden.
Ein Spiel im Wandel der Zeit
Zeitgleich mit den Diskussionen um die Gefahr, die von dem Spiel ausgeht, erlebte „Counter-Strike“ einen kometenhaften Aufstieg. Das Game wurde schnell zu einem der bekanntesten Spiele im E-Sport, der sich seit den frühen 2000er Jahren immer mehr professionalisiert. „Counter-Strike“ wurde nicht nur auf Lan-Partys in den Kellern von deutschen Reihenhäusern gezockt, sondern weltweit in Amateur- und Profiligen.
Tatsächlich schaffte es das Entwicklerteam Valve, diese Begeisterung mit immer neuen Versionen auf einem hohen Niveau zu halten. Das 2012 erschienene „Counter-Strike: Global Offensive“, dem Vorgänger von „Counter-Strike 2“, hat mich persönlich nach einer längeren Pause zu diesem Spiel zurückgeführt. Über 550 Stunden Spielzeit hatte ich in diesem Game auf der Steam-Uhr, verbunden mit vielen großartigen Erlebnissen, knappen und nervenaufreibenden Partien sowie Freundschaften, die ich über das Game pflege oder die dadurch erst entstanden sind. Wie früher auf den Lan-Partys gilt auch heute bei Steam noch: Wenn nichts mehr geht, geht immer noch „Counter-Strike“. Ein kurzweiliger Zeitvertreib – simpel und anspruchsvoll zugleich.
Nicht alles ist Gold, was glänzt

Das ist die eine Seite der Medaille, die glänzende. Es gibt aber noch eine andere. Denn „Counter-Strike“ spiegelt vieles von dem wider, was digitale Gesellschaften schlecht macht. Die Anonymität verleitet einen erschreckend großen Teil der Community dazu, ganz unverhohlen zu beleidigen oder sich über schlechtere Spieler lustig zu machen. Nicht erst seitdem das Spiel vor einigen Jahren kostenlos wurde, hat „Counter-Strike“ mit Spielern zu kämpfen, die Cheats einsetzen und damit ein faires Erleben des Spiels unmöglich machen.
Und dann sind da noch so genannte Lootboxen. Das sind Kisten, die die Spielerinnen und Spieler von Zeit zu Zeit erhalten und in denen sich Waffen mit besonderen Farbmustern befinden. Diese Waffenskins sind eine gute Möglichkeit, um die eigene Spielfigur zu individualisieren. Um an diese Waffen zu kommen, braucht man allerdings einen Schlüssel. Den erhält man für aktuell etwa drei Euro bei Steam. In einer Kiste befinden sich mehrere Waffen, von denen man eine erhält. Öffnet man die Kiste, so läuft eine Art Glücksrad, das nach einer gewissen Zeit anhält. Jene Waffe, die im Sichtfenster zu sehen ist, erhält man dann.
Alleine im März 2023 sollen der Internetseite „CS:GO Case Tracker“ zufolge weltweit knapp 40 Millionen dieser Kisten geöffnet worden seien. Kritiker sehen darin eine Form des illegalen Glücksspiels, weshalb die Lootboxen in Belgien und den Niederlanden bereits vor einigen Jahren verboten wurden.
Ein merkwürdiger Trend
Darüber hinaus ist es bemerkenswert, dass „Counter-Strike 2“ groß angekündigt und von der Community sehnlichst erwartet wurde, das eigentliche Spiel aber im Prinzip nichts Neues bringt. Neben einem Grafik-Update ist da nicht viel. Klar, die Rauchgranaten sehen jetzt hübsch aus. Aber interessanterweise steht gerade dieser Gegenstand für den aktuellen Zustand des Spiels. Viele Kommentatoren stürzen sich auf diese Nebelkerze – und übersehen offenbar, dass der Umfang des Spiels eingedampft wurde, etwa was die Anzahl der spielbaren Karten angeht.
Zudem sind einige Spielmodi entfernt, aber keine neuen hinzugefügt worden. Dass das Szenario und die Kernelemente des Spiels beibehalten werden, immerhin die Erfolgsgaranten seit über 20 Jahren, das liegt zweifelsohne auf der Hand. Dass sich Valve aber nach mehr als zehn Jahren nicht an kleine Veränderungen traut, ist zu kritisieren. Von derzeitigen Problemen, etwa beim Matchmaking ganz zu schweigen. Momentan wirft das Spiel Spielerinnen und Spieler unterschiedlicher Erfahrungsstufen scheinbar wahllos in Partien zusammen, was für alle Beteiligten aufgrund des großen Erfahrungsunterschieds frustrierend sein kann.
Gefühlt reiht sich „Counter-Strike 2“ in die lange Liste der Spiele ein, die unfertig auf den Markt geworfen wurden, obwohl das Game durch Lootboxen ordentlich gemolken wird und seit Jahren funktioniert. Zum Release zockten knapp 1,2 Millionen Menschen das Game gleichzeitig. So viel, wie die anderen neun Spiele der Top-Ten auf Steam zu diesem Zeitpunkt zusammen.
Gerade deswegen verstehe ich nicht, wieso „Counter-Strike 2“ so ist, wie es ist. Die Ziffer 2 im Titel hätte viel Potenzial gehabt, nicht bloß ein grafisches Update zu sein. Vielleicht ist es für mich wieder an der Zeit, das Spiel erneut eine Zeit ruhen zu lassen – nach der nächsten Partie.
"Counter-Strike 2" ist kostenlos auf Steam für den PC erhältlich.