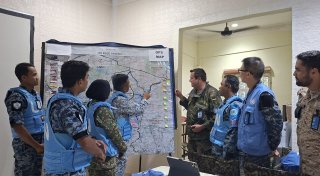Augustdorf. Der Truppenübungsplatz Senne ist ein echtes Naturparadies, obwohl er intensiv militärisch genutzt wird. Gleichzeitig wird hinter den geschlossenen Schranken viel für Naturschutz getan.
Zuständig für Wald und Boden auf dem Truppenübungsplatz ist der Bundesforstbetrieb Rhein-Weser. Matthias Hölscher aus Augustdorf ist einer der fünf Revierförster auf dem 11500 Hektar großen Areal, das als Übungsplatz eine besondere Struktur aufweist. Sie wird gekennzeichnet durch die Straßen, die zumindest zu bestimmten Zeiten für die Öffentlichkeit benutzbar sind. Gleichzeitig ist die Senne einer der am intensivsten genutzten Übungsplätze in Europa, weil sie für die Infanterieausbildung gute Voraussetzungen bietet.
Das Sperrgebiet schafft Refugien für seltene Tiere und Pflanzen. "Zum militärischen Teil der Senne", sagt Hölscher, "gibt es in Nordrhein-Westfalen nichts Vergleichbares."
Und das nicht trotz, sondern wegen des Militärs. Die Präsenz der Truppen habe bisher verhindert, dass die Senne genauso entwickelt und besiedelt worden ist wie die anschließenden Gemarkungen, davon ist Hölscher überzeugt. Außerdem gäben die Platzherren, die britische Armee, jedes Jahr erhebliche Mittel für die Pflege der Landschaft, vor allem der Heideflächen, aus.
Der Militärbetrieb und die damit verbundene Gefahr die von den Flächen ausgeht verhindert auch ein größeres Aufkommen an Besuchern in der Senne. So ist es eine absolute Ausnahme, dass Hölscher einen ganzen Bus mit Angehörigen der Forstbetriebsgemeinschaft Gütersloh/Harsewinkel über die Senne-Straßen dirigiert. Er will den Fachleuten zeigen, wie die naturnahe Waldbewirtschaftung in der Senne aussieht.
Verschiedene Landschaftstypen ziehen an den Busfenstern vorüber: lichte Kiefernwälder auf Sanddünen, dichtere Laubmischwälder auf den letzten Kalklehmausläufern des Teutoburger Waldes, leicht bewaldete Parklandschaften und die raumgreifenden Heide- und Sandmagerrasenflächen, die die Weite und den Charakter der Senne ausmachen. Am Rande eines Waldstücks hat ein Harvester gerade Kiefern gefällt. Hölscher erklärt den Hintergrund. Hier gehe es darum, den großen Eichen am Waldrand mehr Entfaltungsmöglichkeit zu geben. Gleichzeitig solle damit die Verkehrssicherungspflicht erfüllt und die Artenvielfalt erhöht werden. Die alten Eichen sind zudem wichtige Fledermausquartiere.
An anderer Stelle sind es nicht Kiefern, sondern spätblühende Traubenkirschen, die für die Förster ein Ärgernis sind. Vor Jahrzehnten wurden sie vielerorts gepflanzt, heute bedrohen sie die Artenvielfalt, denn sie verjüngen sich stark und lassen kaum andere Baumarten ans Licht, die es auf den mageren Böden der "Streusandbüchse" ohnehin schwer haben.
Immer wieder sind auf den Freiflächen große Rudel Damwild zu sehen. Der Wildbestand ist ebenfalls als Koppelprodukt der militärischen Nutzung und der damit verbundenen "Ruhe" in der Senne enorm. Viele Stücke Schalenwild müssen Jahr für Jahr geschossen werden, um die Population nicht weiter ansteigen zu lassen. "Das muss effektiv und schnell gehen", sagt Hölscher. Doch die knappen Zeitfenster durch den Übungsbetrieb erschweren die Jagd, wohingegen sich Tier und Militär hinter den geschlossenen Schranken bestens verstehen.