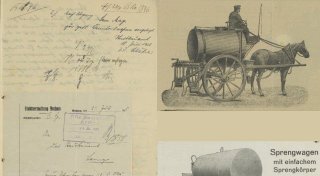Bad Salzuflen. Zwischen den dicken Seiten des alten Gästebuches hängt ein getrocknetes, vierblättriges Kleeblatt. Im privaten Nachlass der Schwestern Julie und Hedwig Müller finden sich mehrere Bücher aus der Zeit, in der sie das Kinderkurheim „Haus Sonnenschein" betrieben haben – von 1911 bis 1954 erst an der Wenken- später an der heutigen Moltkestraße 36. Zwei Kartons voll mit Korrespondenzen, Erinnerungen, Fotos und Unterlagen liegen heute im Salzufler Stadtarchiv. Die LZ hat einen Blick hinein geworfen und die Geschichte des „Hauses Sonnenschein" anhand dieser Dokumente zusammengetragen.
Am 15. Mai 1911 eröffneten die beiden Schwestern aus Soest das Kinderheim „Sonnenschein" in einem Mietshaus an der Wenkenstraße. Schon 1912/13 wurde ein Neubau an der Moltkestraße errichtet. „In diesem Hause mit hellen, freundlichen Schlaf- und Spielzimmern, freien und gedeckten Veranden für Liegekuren und einer Spielwiese haben seit seinem Bestehen viele 1000 Kinder glückliche, frohe und erfolgreiche Erholungswochen verlebt", heißt es in einem Zeitungsbericht zum 40-jährigen Bestehen des Hauses 1951. Karlchen, eines der Kinder, das 1911 im Gründungsjahr zu den ersten kleinen Besuchern zählte, schreibt in einem Telegramm „seinen lieben Tanten" zum Jubiläum, dass es trotz Heimweh eine schöne Zeit gewesen sei.
Ganzjährige Kuren dank Zentralheizung
Die Kinder kamen aus Lippe, aber auch aus Niedersachsen, den Hansestädten, Ostfriesland, Berlin oder Süddeutschland und stammten aus allen Bevölkerungsschichten. „Sehr oft werden Kinder gebracht, deren Väter oder Mütter einst dort selbst erinnerungsreiche Ferienzeiten verlebt haben", heißt es.
Die Schwestern konnten ganzjährig Kuren anbieten, da im Haus eine Zentralheizung vorhanden war – explizit warb man damals auch mit Winterkuren. Platz hatte das Kurheim für insgesamt 20 Kinder im Alter von 2 bis 14 Jahren ohne Begleitung, vor Ort sollten sie „unter liebevoller Pflege und Aufsicht" die Kur verbringen oder die Ferien verleben: „Suchen Sie das Frühjahr und die Osterferien zu einer Erholungskur für Ihre schulmüden Kinder aus", heißt es etwa in einem Flyer.

Fotos zeugen von der unterschiedlichen Unterbringung der kleineren und größeren Kinder. „Große Fenster sorgen für Sonne und gute Durchlüftung der Schlafräume", heißt es. Gelernte Kindergärtnerinnen seien zur Mitbetreuung da gewesen und trieben mit den kleinen Kurgästen Gymnastik, Spiel und Sport – dazu gab es im Garten Spielflächen und sogar einen großen Sandkasten.
Auf "gute kräftige Ernährung" wird viel Wert gelegt
Geworben wurde auch mit der bewährten Heilkraft der Solquellen und dem Gebäudestandort am Wald, dem Garten und der großen Veranda direkt am damaligen Gradierwerk an der Goethestraße. Der Pensionspreis lag zwischenzeitlich bei 30 bis 35 Mark pro Woche, ein Trinkgeld kam noch dazu. Junge Mädchen ab 15 Jahren wurden – sofern Platz war – ebenfalls aufgenommen, sie zahlten 35 Mark pro Woche.
Auf Wunsch standen die Kinder unter ärztlicher Aufsicht. Großer Wert wurde nach eigenen Angaben auf „gute kräftige Ernährung" gelegt, auch besondere Wünsche wurden berücksichtigt. Zum ersten Frühstück gab es laut einem Werbeflyer Milch, Kakao sowie Weiß- und Graubrot mit Butter. Weiter ging es mit einem zweiten Frühstück mit Butterbrot mit Milch, Obst oder Frühstücksflocken. Mittags warteten Suppe, Fleisch mit Gemüse und Kartoffeln, Kompott oder andere Süßspeisen auf die Kinder. Nachmittags gab es Milch oder Weißbrot mit Fruchtgelee oder Honig, zum Abendessen belegte Brote, Eier, Gries- oder Reisspeisen, Aufläufe mit Obst sowie kalte Süßspeisen. Die Angehörigen wurden zudem explizit darum gebeten, den Kindern keine Süßigkeiten mitzugeben oder zu schicken.
Unzählige Einträge in Gästebüchern
Für den Aufenthalt sollten die Kinder einfache, praktische Kleidung im Gepäck haben, dazu ausreichend Schuhzeug, Wettermantel und Gummischuhe, Hand- und Mundtücher, Lätzchen für die Kleinen und Wolldecken für die Liegehalle.
In den Gästebüchern sind unzählige Einträge von 1911 bis in die 1950er hinein zu finden – manche von den Kindern selbst verfasst, andere nur krakelig unterschrieben, hier haben vermutlich die Betreuerinnen mitgeholfen. Immer wieder sind Danksagungen an Tante „Hete" und Tante Julie zu lesen, dazwischen Gedichte, kindliche Malereien und Verzierungen, gute Wünsche und häufig die Versicherung, gerne wiederzukommen oder sogar schon mehrfach zu Besuch gewesen zu sein. 1954 geben die Schwestern das Kinderheim auf – es bleibt danach noch bis 1980 Fremdenheim.
Zwei Schwestern leben ihren Traum
Wer waren die Schwestern Hedwig und Julie Müller und wie hat es sie aus Soest nach Salzuflen verschlagen? Antworten geben Hedwigs Memoiren, die im Salzufler Stadtarchiv einzusehen sind.Hedwig Müller wurde 1882 als eines von neun Geschwisterkindern geboren. Über die Betreuung ihres jüngeren Bruders Carl schreibt sie einmal: „Da wusste und ahnte ich noch nicht, dass ich später mal fast 5000 Kinder in 42 Jahren trösten und betreuen sollte in unserem so geliebten Kinderheim ,Sonnenschein‘".
Sie besuchte die städtische höhere Mädchenschule zu Soest sowie das Töchter-Heim Luisenhaus des evangelischen Diakonievereins in Kassel. 1909 absolvierte sie noch einen Säuglingskursus in Barmen, den sie jedoch aus Krankheitsgründen frühzeitig abbrechen musste.
Ihre Schwester Julie wurde im Juli 1878 geboren, sie soll „die zarteste von den Geschwistern" gewesen sein und wurde von einem Onkel als „unser Prinzesschen" bezeichnet. Sie machte im Lettehaus in Berlin als Handelsschülerin ihr Staatsexamen und trat danach eine Stelle als Korrespondentin in Göttingen an. Drei Jahre blieb sie dort, anschließend half sie im elterlichen Textilgeschäft mit. Der Vater starb 1909 an einer Lungenentzündung, 1910 starb die Mutter.
Nach einer großen Enttäuschung sehnt sich Hedwig nach Arbeit
Die Eltern waren laut Hedwig Müller „vorbildlich in der Erziehung" der Kinder. Sie sollen selbst anspruchslos und sparsam gewesen sein, hätten ihren Kindern nur so überhaupt eine Ausbildung ermöglichen können. Gleichzeitig soll der Vater streng und gütig, die „gute Mutter" nur für die Familie da gewesen sein.
Nach einer großen Enttäuschung, die Hedwig nie ganz überwand, in ihren Memoiren aber nicht weiter ausführt, sehnte sie sich nach Arbeit. Wenig später sollte ihr früherer Wunsch, einmal ein Kinderheim zu führen, in Erfüllung gehen: Wollte sie zunächst nach Sassendorf, riet ihr eine Freundin zu Salzuflen, weil die Stadt „Zukunft hätte".
Unterstützung aus der Familie
Die Brüder Wilhelm und Carl unterstützten die Schwestern, die sich schließlich mit dem Neubau an der Moltkestraße 36 den Wunsch nach einem eigenen Haus am oberen Gradierwerk erfüllten – das Gebäude wurde laut Stadtarchiv nach Plänen des Architekten Rudolf Günther gebaut und steht seit 2006 unter Denkmalschutz. Noch vor Beginn des Ersten Weltkrieges konnten sie einziehen. Aufgrund guter Beziehungen fehlte es nie an Kindern, teilweise sollen sogar bis zu 30 gleichzeitig betreut worden sein. Man setzte auf einige Hilfskräfte und auch Schwester Marie half im Ruhestand zeitweise mit, sie betätigte sich vor allem im Garten.
„Als wir beide über 70 waren, riet besonders Carl zur Aufgabe des Betriebes, den wir 42 Jahre geführt hatten", erinnert sich Hedwig Müller. Auch schlechtes Personal und fehlende Kindergärtnerinnen seien ein Grund dafür gewesen. Die Schwestern lebten danach noch acht Jahre an der Salzufler Blücherstraße. Julie Müller starb 1957, ihre Schwester Hedwig lebte bis 1977.