Kreis Lippe. Wir sind schon besonders, wir Lipper. Wir gießen uns einen Schlürschluck auf die Latüchte, ohne klutendicht zu werden (manchmal), oder schlickern ein Bolchen, bevor wir noch einen Dahlschlag bekommen. Wir haben Fürstenschlösser, Hochschulen, die Landesbrand, den Landesverband, den Hermann, Theater, die Bezirksregierung, das Landesarchiv, Museen, die Landesbibliothek, Staatsbäder. Immens für so einen kleinen Landstrich – und der Tatsache geschuldet, dass Lippe mal ein eigener Staat war. Aber ist deswegen auch das Wesen der Menschen, die von hier wech kommen, so speziell? Womöglich, findet Friedo Petig.
LZ für alle!
Am Donnerstag, 3. Juni, gibt's die LZ für alle in Lippe frei zu lesen. Das ePaper ist ohne Abo zugänglich und viele Geschichten, die normalerweise als LZ-Plus-Artikel veröffentlicht würden, laden alle zum Schmökern ein.Der Landwirt, Humorist und Autor aus Bega ergründet das Wesen der im Schatten des Hermannsdenkmals Geborenen seit Jahrzehnten und hat einige Bücher unter dem Titel „Der Lipper an sich" veröffentlicht. Bald erscheint das sechste in der Reihe. Darin stehen Reime und Witze, die das typisch Lippische outen. Und das tun sie auf ganz lippische Art und Weise: nämlich verschmitzt, hintergründig und zwischen den Zeilen. Einen Film hat er auch gemacht. Will heißen: Der Mann kennt den Lipper wie die eigene Westentasche, schließlich ist er ja einer.
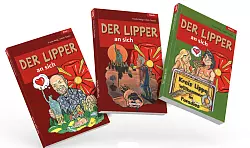
So tickt der Lipper
Der Lipper – tja, er ist als stoisch bekannt, als eher trocken und wortkarg wie ein aufrechter Ostfriese und dafür, dass er emotional eher den Ball flach hält, sich mehr nach innen freut oder trauert und „Kannste nix von sagen" als Maximalkompliment ansieht. „Ich erlebe das durchaus so, wie andere lippische Autorenkollegen und Musiker auch", sagt Petig, dessen Hof in Bega seit fast 500 Jahren besteht, „dass man bei einem Auftritt in regungslose Gesichter blickt und sich fragt: Gefällt denen das überhaupt? Und hinterher sagen sie: Das war so dermaßen megaklasse und lustig, haben wir uns vielleicht amüsiert."
Ja, das eher Distanzierte sei typisch lippisch. „Der Rheinländer ist komplett anders, fröhlich und kommunikativ, der sagt: Drink doch ene met, stell disch net esu ann und lädt einen auch als Fremden auf ein Kölsch ein." Was ein Lipper an einer Theke in der Düsseldorfer Altstadt eher erstmal verdächtig fände und womöglich reserviert auf eine solche Einladung reagierte. Reserviert reagiert auch die lippische Politik manchmal gegenüber denen in Düsseldorf, wenngleich aus anderen Gründen. Ist ja kein Wunder, denn Lippe hatte immerhin mal einen eigenen Landtag.
Von der Infrastruktur her wäre außerdem immer noch alles vorhanden, um sich per Referendum von NRW abzumelden und ein Staat mit Fürstenhaus wie Monaco zu werden – mitsamt eigener Armee in Augustdorf, Flugplätzen in Detmold und Oerlinghausen und Zugang zu den Weltmeeren über die Weser. Wäre das nicht mal was? „Besser nicht", lacht Petig, „aber da ist was dran."
Schenkelwarmer Wachholder
„Dabei", ergänzt Petig, „haben wir viel Humor, einen sehr feinen, der eher zwischen den Zeilen durchklingt." Lippe sei immer ein armes Land gewesen, und „Humor kostet halt nichts". Und wenngleich die Ziegler und Wanderarbeiter das lippische Wesen nach außen trugen, war es mit dem Import immer schwierig. Noch heute gilt das Wort vom „Beutelipper" und die Faustregel, dass man frühestens nach 50 Jahren als assimiliert gilt.
„Es gab", so Petig, „ja auch bis in die 60er Jahre Probleme, wenn jemand zum Beispiel nach Höxter heiraten wollte." Logisch – denn das evangelische Lippe war stets von katholischen Zonen umgeben. Und: „Kaum überschreitet man die Grenzen, sieht es da ja oft ganz anders aus, die Häuser sind anders gebaut", weiß Petig.
Das mit der Sparsamkeit, sagt Petig und zeigt zum Beweis auf zwei Bücher, werde uns ja seit je nachgesagt. Schon in den Druckwerken „Menschen vom Lippischen Boden" oder „Das Lippische Lehrerseminar" würden solche Eigenarten beschrieben und der Lipper als speziell gekennzeichnet. Mit der Sparsamkeit habe man sich auch mal ins eigene Fleisch geschnitten – Hinweise auf die Hermanns-Schlacht finde man hier nirgends, weil: „Der Lipper lässt ja nichts liegen." Ob der adriatische Einfluss der römischen Besatzer zur lippischen Pizza geführt habe, dem bestenfalls mit einem schenkelwarmen Wachholder zu genießenden Pickert, bleibt ebenfalls im Dunkel der Geschichte verborgen.
Dabei, findet Petig, sei die Sparsamkeit ja eine Tugend. Wir, die geografisch so ziemlich in der Mitte Europas lebten, hätten doch diese Botschaft der Welt zu vermitteln: „Seid sparsam, Verschwendung ist ein Laster." Das gelte für Energie, Ressourcen ... „Früher", sagt Petig, „ließ man nichts verkommen. Da wurde eingekocht und aus den letzten Resten eine Suppe gemacht. Es wurde gemahnt: Mach mal das Licht aus! Es wurden Kleidungsstücke in der Familie weitergeben." Was in unserer Wohlstandsgesellschaft ja völlig anders aussehe. „Wegwerfen", so Petig, „das hat der Lipper nicht vorgelebt. Seine Kernbotschaft ist das Maßhalten."
Wisch doch mal über's Tablet
Und da zitiert Petig gerne einen Song der lippischen Band „Mr. Blues", in der die Oma die feiernden Jugendlichen warnt: „Geht nicht durchs Geharkte!" Genau darum gehe es. Macht, was ihr wollt, aber haltet Maß, geht nicht durchs Geharkte. Ein Motto, das durchaus an den Nachkriegsaufruf des lippischen Landespräsidenten Heinrich Drake erinnert: „Bekakelt nicht die Lage." Auch dem ging es ums Maßhalten, um das auf dem Teppich bleiben.
Und wenn mal einer wie Graf Friedrich Adolf zwischen 1701 und 1704 das Land fast in den Ruin trieb, weil er es mit der Parklandschaft Friedrichstal in ein Versailles verwandeln wollte, wurde er an den Verlust seiner Tugend gemahnt, namentlich von Zar Peter, dem Großen, der anlässlich einer Jagdgesellschaft bei Bad Pyrmont den Regenten ermahnte: „Euer Liebend sind zu groß für dieses Land."
Ja, maßhalten. Insofern komme es darauf an, welchen Lipper man betrachte, wenn man nach seinem Wesen forscht. Den von damals, dem man sagte: „Wisch mal über’s Tablett." Oder dem von heute, für den gilt: „Wisch mal über’s Tablet?" Hier zeige sich, dass das Urlippische zwar inzwischen verwässert sei. Dennoch stecke das Bewusstsein der aktuellen Generation noch in der DNS. Anders sei die aufgeregte Debatte ja nicht zu erklären, die das neue Logo der Kreisverwaltung mit der stilisierten Rose losgetreten habe. Die Identifikation mit dem Symbol sei groß, aber: „Die Welt verändert sich nun mal und mit ihr Lippe und der Lipper, da muss man auch mal was Neues versuchen dürfen", sagt Friedo Petig. „Aber doch bitte nicht auf Kosten der lippischen Rose. Die ist und bleibt unser Wahrzeichen."








