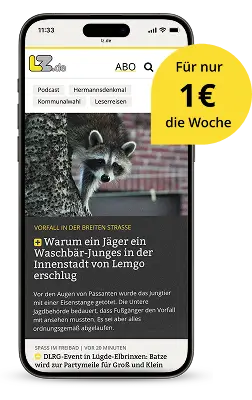Oerlinghausen. Ein reges jüdisches Gemeindeleben herrschte im früheren Oerlinghausen. In ihrer aktivsten Zeit um 1870 meldete der Ortsvorsteher des Bergdorfes insgesamt 74 Mitglieder an die fürstliche Verwaltung, fast 40 davon waren Kinder unter 14 Jahren. Eine Synagoge, aus Holz gebaut, stand im Mittelpunkt der Gemeinde. Das Gebäude, das um 1800 errichtet wurde, lag unmittelbar hinter der heutigen Synagoge, dem Ausstellungsraum des Kunstvereins an der Tönsbergstraße. „Die Witwe des Schutzjuden David Meyer schenkte der jüdischen Gemeinde den Platz hinter ihrem Haus“, schreibt der Historiker Alex Moll in einer Chronik.
In der weltoffenen und liberalen Zeit der Fürstin Pauline (1769 – 1820) genehmigte die fürstliche Verwaltung der Oerlinghauser Gemeinde eine eigene Synagoge auch deshalb, weil „dieser Platz von der Kirche so weit entlegen ist, dass der christliche Gottesdienst durch die Synagoge nicht im Geringsten gestört werden kann.“ Aber da die hölzerne Synagoge im Laufe der Jahrzehnte immer maroder wurde, unternahm man häufig Anläufe, um ein neues Gotteshaus zu errichten und reichte auch Pläne ein. Doch nie konnte geklärt werden, ob es tatsächlich zu einem Neubau kam oder die alte Synagoge nur renoviert und umgebaut wurde.

Erst im Jahre 1893 entstand das Synagogengebäude aus Stein, so wie es heute zu sehen ist – damals allerdings noch mit einem Türmchen auf dem Dach. Ein eigener jüdischer Begräbnisplatz lag schon seit langer Zeit zuvor weiter oben am Berg. Noch heute ist der jüdische Friedhof dort zu besichtigen. Einen eigenen Rabbiner besaß Oerlinghausen nicht. Im späteren 19. Jahrhundert gab es einen Geistlichen, der von allen jüdischen lippischen Gemeinden bezahlt wurde und der auch hier Gottesdienste abhielt.

Das jüdische Leben in Oerlinghausen wurde von mehreren Geschäftsleuten bestimmt. Die Familien Paradies, Bornheim, Kulemeyer, Meyer, Windmüller und Herz tauchen in Oerlinghauser Chroniken immer wieder auf. So erwarben die Zigarrenfabrikanten Moses und Heinemann Paradies zum Beispiel um 1860 das große Geschäftsgebäude gegenüber der Kirche, den sogenannten Langen Gottfried. Sie überließen der Synagogengemeinde einen Raum für eine Elementarschule und man stellt einen Lehrer fest ein. Im Keller des großen Hauses entstand ein jüdisches Bad, eine Mikwe zur rituellen Körperreinigung. Neben dem langen Gottfried lag das Textilgeschäft von Bornheims. Ein weiteres Geschäft betrieben Paradies später am Simons-platz. Die Familie des Viehhändlers Kuhlemeyer erwarb ein Haus an der damaligen Bahnhofstraße, heute Rathausstraße.
Jüdische Mitbürger waren geachtet und völlig integriert in das gesellschaftliche Leben der Gemeinde. Hohes Ansehen besaß zum Beispiel der jüdische Arzt Dr. Max Meyer, der in der Reuterstraße lebte und im Jahre 1918 zum Sanitätsrat ernannt wurde. Sein Bruder Joe Meyer war der erste Geschäftsführer des Oerlinghauser Elektrizitätswerkes. Beide zeigten sich als aktive Bürger und Mitglieder in vielen Vereinen. Else Windmüller, Tochter des Viehhändlers Julius Windmüller von der Detmolder Straße, wurde beim Schützenfest 1913 zur Schützenkönigin auserwählt – ausgerechnet vom späteren NSDAP-Ortsgruppenleiter Paul Reuter.
Das Gemeindeleben endete nach und nach
Allerdings begann schon Ende des 19. Jahrhunderts der Schrumpfungsprozess der jüdischen Gemeinde. Innerhalb kurzer Zeit zogen vier Familien aus Oerlinghausen aus unbekannten Gründen weg. Die wenigen übriggebliebenen Familien schickten ihre Kinder zum jüdischen Religionsunterricht nach Lage. Später, gegen Ende der 1920er Jahre, fanden schon keine Gottesdienste mehr in der Synagoge statt, denn nach jüdischem Recht braucht es zehn Männer über 14 Jahre, um einen Gottesdienst abzuhalten. Das religiöse Gemeindeleben endete quasi schon vor der Machtergreifung der Nazis im Jahre 1933.
Doch dann begann der psychischer Druck und alltägliche Hetze gegen Juden in ganz Deutschland. Auch in Oerlinghausen nahmen die Demütigungen und Beschimpfungen auf offener Straße zu. Der Chronist Jürgen Hartmann schreibt: „Dieser tägliche Terror bewegte eine Reihe jüdischer Bürger, ihrer Heimatstadt den Rücken zu kehren.“ Einige wanderten nach Südamerika aus, manche auf die Philippinen, andere verzogen innerhalb Deutschlands. Im Jahre 1938 verkauften die letzten Gemeindevorstände Siegfried Bornheim und Heinrich Herz für 1.300 Reichsmark die Synagoge an den staatenlosen Schuhmacher Johann Sikka. Dieser richtete sich alsbald eine Werkstatt und eine Wohnung in dem Gebäude ein. Zum Zeitpunkt des Novemberpogroms, der sogenannten Reichskristallnacht, 1938, lebten nur noch die dreiköpfige Familie Herz und das Ehepaar Eduard und Else Kulemeyer in der Stadt. Da die SA auch das Geschäft stürmte und die Familien drangsalierte, verkaufte Familie Herz ihr Haus und zog ins anonymere Hamburg. Kulemeyers blieben vorerst. Vollkommen isoliert versuchten sie, auszuwandern – ohne Erfolg. Beide Familien überlebten den Terror nicht. Kulemeyers wurden im Dezember 1941 im KZ in Riga ermordet.
Heinrich und Irma Herz transportierten die Nazis zusammen mit ihren Kindern im November 1941 aus Hamburg ins Ghetto im weißrussischen Minsk, wo sie ebenfalls umkamen. Das war das Ende der jüdischen Gemeinde in Oerlinghausen.