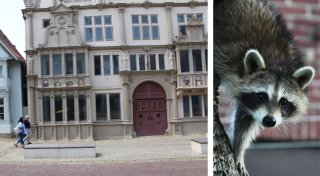Lippes Füchse erleben gerade eine gefährliche Zeit. Wie viele andere Jagdgemeinschaften macht auch der Hegering Lügde-Köterberg in der laufenden Woche Jagd auf das Raubwild. Was die Jäger für sich als Naturschutzmaßnahme reklamieren, ist für die Tierschutzorganisation Peta ein blutiger, unzeitgemäßer Zeitvertreib. Eine Debatte mit viel Zündstoff.
Diskussion um Raubwildwochen
Tierschützer werfen Hegering Lügde-Köterberg „sinnloses Töten“ vor