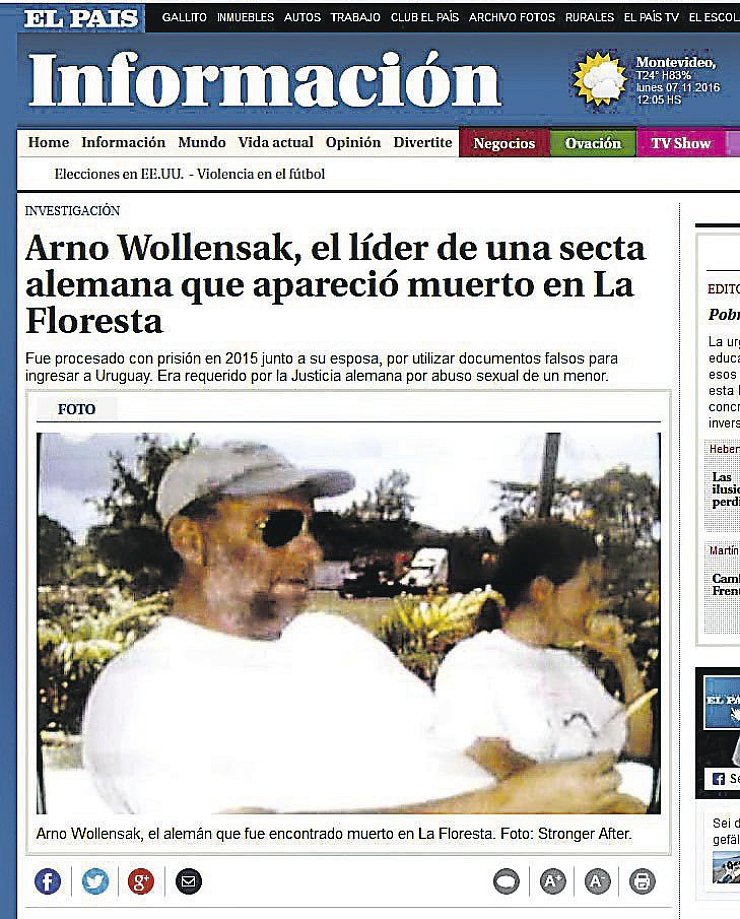
Montevideo/Hiddenhausen/Oerlinghausen. Der Tod des Sektengurus Arno Wollensak aus Oerlinghausen ist noch immer ungeklärt. Im August wurde er mit einer Plastiktüte über dem Kopf, angelegten Handschellen und gefesselten Füßen an einem Strand in Uruguay tot aufgefunden. Laut Gerichtsmedizinern wurde er erstickt.
Der Mord wirft in Uruguay viele Fragen auf. Monate nach dem Fund der Leiche hat die Polizei fünf Männer und drei Frauen in Gewahrsam genommen, doch die Verdächtigen sind wegen fehlender Haftgründe schon wieder auf freiem Fuß. Die Polizei ermittele weiter in verschiedene Richtungen, erklärt Hauptkommissar Mario Layera. Sie sucht vor allem nach Wollensaks Ehefrau, Julie R.
Wollensak, Führer der Sekte Lichtoase, sollte im April 2007 vor dem Landgericht Detmold der Prozess wegen Kindesmissbrauchs gemacht werden. Wenige Tage vor dem Gerichtstermin verschwanden der Angeklagte und seine Lebensgefährtin. Wollensak soll die Schweizerin Lea Saskia Laasner, die mit ihren Eltern im Alter von 12 Jahren der Sekte beitrat, sexuell missbraucht haben. Nach ihrer Flucht im Jahr 2001 schrieb Laasner ein Buch über ihr Leben in der Sekte.
Die forensische Psychiaterin Adriana Savio hat den Kriminalfall Wollensak analysiert. Sie kommt zu dem Schluss, dass Wollensak kein Soziopath war. „Wir sprechen hier von einer Persönlichkeitsstörung mit dem starken Hang, Beziehungen zu anderen herzustellen", erklärt Savio. Zu diesem Beziehungsgeflecht gehörten auch die Mütter, die ihre jungen Töchter Sektenführer Wollensak als Sexsklavinnen auslieferten. Für Savio hat der Zustand, in dem seine Leiche gefunden wurde, einen Symbolcharakter, der die „interne Logik der Sekte" erkennen lässt. „Der Körper gefesselt, der Mund mit Klebeband gestopft, all das ist eine Botschaft an Dritte, die Angst verbreiten soll."
Das Bundeskriminalamt übernahm den Fall im April 2014 von der Detmolder Staatsanwaltschaft. Die BKA-Zielfahnder wurden eingeschaltet, als sich die Spur von Wollensak und seiner Frau in Südamerika verlief. Letztlich wurden die Gesuchten in Uruguay aufgespürt. Sie hielten sich auf einem durch Sektenmitglieder finanzierten Anwesen auf. Beide wurden dem Haftrichter in Montevideo vorgeführt. Wollensak und Julie R. waren in Uruguay mit Pässen des südamerikanischen Staates Surinam mit falschen Namen eingereist.
Nach dem Tod von Wollensak verfolgt die Detmolder Staatsanwaltschaft die Anklage gegen den Sektenguru nicht weiter. „Mit dem Tod ist der Fall erledigt", sagt Oberstaatsanwalt Ralf Vetter. Seine Frau Julie R. werde aber weiterhin gesucht, erklärt der Anklagevertreter.
Bis zur Gründung der Sekte lebte Wollensak ein unauffälliges Leben. Er wuchs in Oerlinghausen auf und schloss seine Schullaufbahn am Gymnasium nach der Trennung seiner Eltern ohne Abitur ab.
Anfang der 1980er-Jahre zog Wollensak nach Hiddenhausen im Kreis Herford, in einen Kotten der Familie Greßhöner im Stadtteil Lippinghausen. Hans Greßhöner erinnert sich an den Tag, als Wollensak plötzlich auf dem Hof stand. „Er erkundigte sich nach einem der Kotten, die wir damals vermietet haben", erklärt der 64-jährige Landwirt. Einige Monate später unterschrieb Wollensak den Mietvertrag. „Er zog mit seiner Freundin aus Bielefeld in den Kotten und vermietete Zimmer an Studenten." Greßhöner geht davon aus, dass Wollensak mit der Zimmervermietung Gewinn machte. „Er hat es immer irgendwie geschafft, an Geld zu kommen", sagt Greßhöner. „Mit unterschiedlichen Geschäftsideen und Engagements."
Anfang der 1980er-Jahre schaffte sich Wollensack einen Industriebackofen an und backte Biobrötchen, die er an Bäckereien auslieferte. Kurz darauf wurde er als Techniker für die Ruhrfestspiele engagiert. Mit der Gage finanzierte er den Besuch bei der Baghwan-Bewegung im indischen Poona, wo er auf viele Berliner traf.
Vermieter erinnert sich an Wollensak als selbstbewussten Mann
1983 verließen Wollensak und seine Freundin Lippinghausen und zogen nach Berlin. „Ich war erleichtert, weil es immer wieder Ärger mit ihm gab. Ich habe Arno Wollensak als einen Mann erlebt, der viel verspricht, aber nichts einhält", sagt Greßhöner. Der Landwirt erinnert sich auch an das ausgesprochen große Selbstbewusstsein des Mannes. „So habe ich ihn auch bei einem Besuch in den 1990er-Jahren erlebt, als er mit seinem Sohn plötzlich wieder auf dem Hof stand." Allerdings war Wollensak bei seinem Besuch schweigsamer als sonst. „Ich wusste, dass er in einer WG in einer Villa in Berlin lebte und von Unterstützern finanziert wurde, doch er gab nicht mehr viel von seinem Leben preis."
Seit dem Besuch in den 1990er-Jahren hatte Greßhöner keinen Kontakt mehr zu seinem ehemaligen Mieter. Erst als Laasner die Missbrauchsvorwürfe gegen Wollensak in ihrem Buch „Allein gegen die Seelenfänger" öffentlich machte, erfuhr Greßhöner von Wollensaks Machenschaften in der Sekte. „Ich habe mich seitdem immer gefragt, wie es dieser Mann geschafft hat, Menschen in einer Sekte um sich zu scharen."

