Bielefeld. Italien – gelobtes Land der Musik. Bekannte Komponisten wie Schütz, Händel und Mozart brachen zum Lernen und Arbeiten dorthin auf. Der deutsche Einfluss auf das Land von Verdi und Puccini intensivierte sich in der Nachkriegszeit: Italienische Komponisten knüpften an die Zwölftonmusik der sogenannten Darmstädter Schule an – oder grenzten sich bewusst von ihr ab. Diesem kulturellen Wechselverhältnis geht das Detmolder Ensemble Horizonte in dem neuen Videopodcast „Römische Horizonte“ nach.
Die ersten fünf halbstündigen Folgen sind in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen Institut in Rom an Schauplätzen in der italienischen Metropole entstanden. Zwei weitere, in Ostwestfalen aufgenommene Videos zu Kompositionen mit Rom-Bezug sollen demnächst hinzukommen.
Der Videopodcast richtet sich „an alle, die Musik mögen und neugierig sind“, sagt Sabine Ehrmann-Herfort, Leiterin der Musikgeschichtlichen Abteilung des vom Bundesbildungsministerium finanzierten Instituts. Jede Podcast-Folge ist einem Musikstück gewidmet. Die Musikwissenschaftlerin erläutert zusammen mit Jörg-Peter Mittmann, Leiter des Ensembles Horizonte, Hintergründe und musikalische Besonderheiten des jeweiligen Werks.
"Jedes Stück ein eigener Kosmos"
Mitglieder des Ensembles stellen Klangbeispiele und ungewöhnliche Spieltechniken vor. Anschließend werden die Stücke in Kirchen, in dem von einem arkadisch anmutenden Garten umgebenen Deutschen Historischen Institut oder auch in einem mittelalterlichen Palazzo in der Umgebung Roms gespielt. „Jedes Stück ist ein eigener Kosmos“, sagt Sabine Ehrmann-Herfort. Der Videopodcast erleichtert das Eintauchen.
Den Anfang macht Jörg-Peter Mittmanns „Lamento“ (2008). Drehort ist die Kirche Santa Maria dell’Anima, Gotteshaus der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Rom. Das Stück nimmt explizit Bezug auf die musikalische Vergangenheit des 17. Jahrhunderts.
Rückgriffe auf die Tradition waren in der zeitgenössischen Musik zunächst verpönt; nach den Verbrechen des Faschismus wurde ein radikaler Neuanfang gesucht. Inzwischen versteht sie sich als Teil der Tradition. „Auch die Neue Musik schöpft nicht aus dem Nichts“, sagt Sabine Ehrmann-Herfort.
Geheimnisvolle Klänge
Im Mittelteil von Mittmanns „Lamento“ klingt Claudio Monteverdis hochemotionales „Lamento della ninfa“ an, ein Monument musikalischer Tradition. „Die Strahlkraft des absteigenden Lamento-Basses ist auch im 21. Jahrhundert ungebrochen“, erläutert der Komponist. Klarinette, Flöte, Cello und Harfe demonstrieren im Video, wie im Stück zu hörende geheimnisvolle Klänge zwischen Ton und Geräusch erzeugt werden.
Der aus Sizilien stammende Komponist Salvatore Sciarrino (76) kommt im Podcast ebenfalls zu Wort. Ihm sind gleich zwei der ersten fünf Folgen gewidmet. Sciarrinos besondere Klangwelt entstand als Gegenentwurf zur sogenannten Darmstädter Schule, die in der zeitgenössischen Musik der Nachkriegszeit dominierte. „Aus der Musik war all das verbannt, was die Emotionalität betraf“, erinnert sich Sciarrino. „Die einzig mögliche Reaktion bestand meiner Meinung nach darin, die Musik mit all den anderen Künsten zu verbinden.“
Mit „Fauno che fischia a un merlo“ (1980), einem Dialog zwischen Flöte und Harfe, bezieht sich Sciarrino auf Arnold Böcklins Gemälde „Faun, einer Amsel zupfeifend“. In „Muro d’orrizonte“ (1997), das im Palazzo Chigi in Formello nördlich von Rom musiziert wird, überraschen den Hörer Klänge, die an einen verzerrten E-Gitarrensound oder elektronische Musik denken lassen.
Kleine Nachtmusik
Die Podcast-Folge zu Luigi Dallpiccolas kleiner Nachtmusik „Piccola musica notturna“ wurde in der evangelisch-lutherischen Christuskirche in Rom aufgezeichnet, einem Kirchenbau vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Dallapiccola (1904–1975) pflegte eine enge Verbindung zur deutschen Musikszene und gilt als derjenige, der die revolutionäre Zwölftontechnik in Italien einführte. Am Beispiel seiner Nachtmusik erläutern Ehrmann-Herfort und Mittmann Grundzüge atonalen Komponierens. Komplexere Reihenfiguren spielt das Ensemble zum besseren Verständnis „in Zeitlupe“ vor.
Ein Einblick in die Wohn- und Arbeitsräume Giacinto Scelsis (1905–1988) wird in der Folge zu Scelsis „Arc en ciel“ gewährt. Geige und Bratsche stellen spezifische Merkmale dieser meditativ dahinfließenden Musik vor, unter anderem Viertelton-Reibungen. Eigentlich hätte auch ein Video zu einem Werk Hans Werner Henzes (1926–2012) in dessen Wohnort Marino bei Rom gedreht werden sollen. „Unglückliche Umstände haben das leider verhindert“, sagt Mittmann bedauernd. (Der Podcast „Römische Horizonte“ kann über die Website des Deutschen Historischen Instituts in Rom angeschaut werden: dhi-roma.it. Am 3. März 2024 gibt das Ensemble Horizonte ein an den Podcast angelehntes Konzert im Theater Gütersloh.)
Neue CD: Fragile Klangbilder
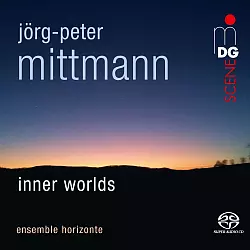
Fast zehn Jahre nach „Kontrapunkte“ legt der Detmolder Komponist und Oboist Jörg-Peter Mittmann eine zweite Porträt-CD mit eigenen Werken vor: „Inner Worlds“. Die fünf zwischen 1997 und 2022 entstandenen Kammermusikstücke, eingespielt in der Abtei Marienmünster mit dem Ensemble Horizonte, wurden durch Gedichte, Gemälde oder auch tradierte Musik angeregt. „Fragile Harmonie“ für acht Instrumente etwa greift charakteristische musikalische Ausdrucksmuster Beethovens auf: hoch energetische Akkord-Ballungen, diffuse Suchbewegungen. Gedichtfragmente über Heimatverlust und Entwurzelung inspirierten das Stück „Sieben Strophen Heimat“, das Katrin Bähre mit eindringlichen Vokalisen und gesprochenen Gedichtzeilen prägt. Die impulsive Pinselführung des Informel sowie Bilder Paul Klees überträgt Mittmann in „Gesten im Schwung“ und „Bilder des Südens“ in suggestive eigene Klangbilder. Der Zyklus „Spektral“ schließlich findet tönende Entsprechungen für ungewöhnliche Farbsymbolik („schwarzer Wind“) in Georg Trakls Lyrik. Filigrane Musik, die Kunst anderer Gattungen neu erfahrbar macht. (tom)






