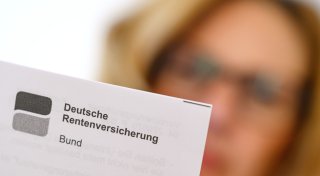Die Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung lassen sich sehr plastisch darstellen. Anfang der 1960er-Jahre kamen auf einen Rentner noch sechs Beitragszahlende. Durch die Alterung der Gesellschaft sind es aktuell nur noch zwei Beschäftigte – Tendenz sinkend, schließlich gehen nun die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer schrittweise in Rente. Es ist nicht schwer zu verstehen, dass diese Entwicklung Folgen für die Beiträge und das Niveau der Altersbezüge haben muss.
Bisher hat es sich die Politik leicht gemacht und auf Lösungen gesetzt, die einseitig die jüngere Generation belasten. Am ärgsten trieb es hier die Ampel-Regierung, die ein Absinken des Rentenniveaus allein durch höhere Beiträge der Erwerbstätigen verhindern wollte. Glücklicherweise landete der Rentenplan im parlamentarischen Mülleimer, weil die Ampel vorzeitig scheiterte.
Die bereits auf den Weg gebrachte Reform der schwarz-roten Koalition ist in dieser Hinsicht allerdings nur wenig besser: Zwar wollen auch Union und SPD das Rentenniveau stabilisieren, die Mehrausgaben dafür wollen die Koalitionäre aber aus dem Bundeshaushalt finanzieren – also aus den Steuerzahlungen aller Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen. Immerhin wird die Last so besser verteilt, es bleibt aber dabei, dass die Jüngeren weiterhin die größten Opfer bringen müssen.
Experten empfehlen den „Boomer-Soli“
Fair ist das also nach wie vor nicht. Hier kommen nun die Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung mit ihrem Vorschlag eines „Boomer-Soli“ ins Spiel. Sie rütteln an dem, was in der Politik bisher als Tabu gilt: Kein Abladen der zusätzlichen Lasten bei den jüngeren Menschen, sondern eine Lösung allein innerhalb der Rentnergeneration selbst.
Das ist möglich und auch angemessen, weil wir es hier mit einer äußerst heterogenen Gesellschaftsschicht zu tun haben: Viele Rentnerinnen und Rentner haben so wenig Geld, dass sie auf Sozialleistungen angewiesen sind, während andere durch Betriebsrenten, Immobilien oder Aktiendepots ein Leben in einem mehr als auskömmlichen Wohlstand führen können. Ihre Schultern könnten mehr tragen.
Kritisch ist allerdings das Modell zu sehen, die Umverteilung allein im Rentensystem vorzunehmen. Eine Reduzierung des Rentenniveaus ohne Gegensteuern würde bedeuten, das Armutsrisiko der älteren Bevölkerung deutlich zu erhöhen. Wenig zielführend wäre es auch, das Rentenniveau bei Wohlhabenden stärker zu senken, um damit die niedrigeren Renten zu stabilisieren. Denn das würde die Grundfesten der gesetzlichen Rentenversicherung erschüttern. An dem sogenannten Äquivalenzprinzip – die Rente folgt dem, was Beschäftigte von ihrem Einkommen eingezahlt haben – sollte nicht gerüttelt werden, weil es ein wesentlicher Baustein für die Akzeptanz des gesamten Systems ist.
Sonderabgabe würde zwei Probleme lösen
Umso bestechender ist das Modell des „Boomer-Solis“, also einer Umverteilung innerhalb der Rentnergeneration über eine Sonderabgabe auf höhere Altersbezüge und die Vermögenseinkommen. Dabei könnten sogar zwei Probleme auf einmal gelöst werden: Ließe man die Erwerbseinkommen unangetastet, wäre das für die ältere Generation ein durchaus lohnender Anreiz, um freiwillig länger zu arbeiten.
Leider gibt es einen Haken. Eine derartige Abgabe ist zwar technisch unkompliziert, aber nur schwer politisch umsetzbar. Die Generation 60 plus ist mit einem Anteil von über 42 Prozent schon jetzt mehr als dreimal so stark wie die Gruppe der unter 30-jährigen Wählerinnen und Wähler. Realistischerweise wird es keine Partei wagen, Entscheidungen gegen die Boomer zu treffen. Für die junge Generation sind das keine guten Aussichten.