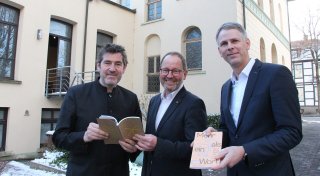Kreis Lippe. Ihn an die Strippe zu kriegen, ist schwierig. Denn Prof. Dr. Sascha Friesike ist viel unterwegs. „Ich bin um 14.30 Uhr auf dem Flughafen in Dublin, da können wir telefonieren", mailt der Wirtschaftsingenieur, der am 25. September den Auftakt der Veranstaltungsreihe „Zukunftsperspektiven" bestreitet. Prompt ist das Interview untermalt von den Lautsprecheransagen.
Herr Professor Friesike, was machen Sie bloß in Dublin?
Prof. Dr. Sascha Friesike: Meine Freundin und mein Kind leben in Dublin, also bin ich häufig hier.
Sie lehren in Amsterdam, sind viel auf Vortragsreise. Wie kriegen Sie das alles auf die Reihe?
Friesike: Vor 30 Jahren hätte ich den Job so nicht machen können. Aber heute habe ich mein Büro dabei, wenn ich ein Netz habe, ist das zu machen.
Sie werden in Detmold über „Irrtümer der Digitalisierung" sprechen, auch über die Verfügbarkeit von Wissen. Wann haben Sie zum letzten Mal in ein Lexikon aus Papier geguckt?
Friesike: (lacht) Lustig, dass Sie das fragen. Das ist nämlich gar nicht lange her. Wenn ich in Dublin bin, setze ich mich zum Arbeiten in die Unibibliothek. Da ist Ruhe. Zwischen all den Büchern habe ich vor wenigen Tagen erst in der Enzyklopädia Britannica geblättert, noch so eine richtig alte, in Leder gebunden.
Worum geht es, wenn Sie von Irrtümern der Digitalisierung sprechen?
Friesike: Die Digitalisierung betrifft inzwischen quasi alle Lebensbereiche. Die damit verbundene Veränderung in unserer Gesellschaft ist enorm. Dabei ist alles deutlich komplexer, als es gern dargestellt wird. Wenn wir fragen, was die Digitalisierung für unsere Gesellschaft bedeutet, schwanken die Reaktionen zwischen blinder Euphorie und totaler Ablehnung. Gern werden Kochrezept-Lösungen gefordert, die es leider nicht gibt.
Worauf kommt es an, um den richtigen Umgang mit der Digitalisierung zu finden?
Friesike: Ganz entscheidend ist sicher die Rolle der Kreativität. Routinetätigkeiten lassen sich per Algorithmus leicht digitalisieren, kreative Problemlösungen kaum. Es wird also immer wichtiger, sich kritisch mit Themen auseinanderzusetzen und die eigene Aufgabe neu zu interpretieren.
Vermutlich ist es auch viel schwieriger, diese Fähigkeit dem Nachwuchs zu vermitteln.
Friesike: Es ist eine große Herausforderung. Die Digitalisierung erzeugt Unruhe.
Klingt, als müssten wir da schon beim Bildungssystem anfangen.
Friesike: Das stimmt, und da dürfte sich für meinen Geschmack auch mehr bewegen. Deutschland ist ein konservatives Land, die Bildung leidet hier gern unter einer Art Stockholmsyndrom. Ältere sagen: Wir haben das auch durchgemacht, also muss die nächste Generation durch das Gleiche durch.
Wie lässt sich diese Haltung ändern?
Friesike: Wir müssen umdenken in dem, was wir unterrichten: Die Schüler müssen besser lernen, ihr eigenes Tun zu präsentieren und gemeinsam mit anderen zu arbeiten. Sie müssen Selbstbewusstsein entwickeln, um sich zu trauen, kreativ zu sein. Und sie brauchen einen kritischen Geist, müssen lernen, sich selbst ein Urteil zu bilden. Diese Wertschätzung für unabhängiges Denken brauchen wir. In meinen Kursen sollen die Studenten etwas Eigenes entwickeln, sich inspirieren lassen und ihren eigenen Standpunkt begründet darlegen. Doch das ist nicht so einfach, viele Studenten denken, dass ein freundliches Abnicken einfacher zu guten Noten führt.
Eine neue Runde beginnt
Die Reihe Zukunftsperspektiven von LZ, der Akademie Denkflügel, der Lippe Bildung eG, Beresa und Weidmüller im Hangar 21 beginnt am Dienstag, 25. September, um 19 Uhr. Einzelkarten gibt’s für 49,90 Euro in allen LZ-Geschäftsstellen. Getränke und Speisen von Liebharts Privatbrauerei und Vera Veggie sind im Preis inbegriffen.
Der erste Referent Sascha Friesike (Foto), Jahrgang 1983, ist Assistant Professor für digitale Innovation an der VU Universität in Amsterdam. Zuvor war er Professor für Innovation und Entrepreneurship an der Uni Würzburg und Forschungsleiter am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) Berlin.