Oerlinghausen. Was war das für ein Theater in Oerlinghausen – damals vor fast 25 Jahren. Ein Buch war auf den Markt gekommen, das den Schulalltag am Niklas-Luhmann-Gymnasium in einer Satire beschrieb. Schulleiter Friedrich Mahlmann hatte das Werk geschaffen. Ironisch und mit bissigem Humor karikierte er sich selbst, insbesondere seine Kollegen des Gymnasiums und auch bekannte Oerlinghauser Bürger. Die Folge: Ein riesiger Spaß für die meisten Menschen, höchster Ärger herrschte bei wenigen Betroffenen, vor allem bei einigen Lehrern des Gymnasiums. Zwei Pädagogen verklagten ihren Schulleiter, gingen durch sämtliche Instanzen – bis zum Bundesverfassungsgericht. Und verloren.
Das sorgte für Schlagzeilen. Große Zeitschriften wie die „Zeit“ oder der „Focus“ nahmen Oerlinghausen (alias Rodenburg) und das Buch „Pestalozzis Erben“ zum Anlass, um das verbeamtete Schulwesen zu bespötteln: Paukerposse in der Provinz. Die Bildzeitung titelte: Riesenwirbel um Lehrersatire. Das Pikante an dem Buch nämlich war: Obwohl Mahlmann in seiner Satire alle Namen geändert hatte, konnte man die Personen des Buches lupenrein erkennen. Oswald Zuche zum Beispiel. „Er unterrichtet Deutsch und Sport, ist aber faul, unpünktlich und feiert mindestens einmal im Monat krank.“ Nachmittags allerdings wurde Zuche trotz ständigen Rückenleidens munter auf dem Tennisplatz gesehen. Oder Hubert Röckmann, der Religion unterrichtete. Röckmann sei ein Alt-68er, der ständig Betroffenheit verbreite, Menschenketten und Schweigemärsche organisiert und im Unterricht für die Gegner der Nachrüstung beten lässt, heißt es. Bei den Schülern war er bekannt als der, „der sich die Haare in der Friteuse wäscht“. „Als katholischer Religionslehrer sah er sich in der unmittelbaren Nachfolge Jesu Christi“, schrieb Friedrich Mahlmann, der sich selbst den Namen Heinrich Kah gegeben hatte.
Ebenso der Lehrer Carl-Gottfried Albers, der gegen den „menschenverachtenden Leistungsdruck des Gymnasiums“ kämpfte und öffentlich erklärte, dass er die Versetzungsordnung nicht mehr anwenden wolle. Der Hintergrund allerdings: sein Sohn war zum zweiten Mal sitzengeblieben und Albers legte Einspruch gegen den Beschluss der Konferenz ein. Der Pädagoge Lausbach war offenbar auch ein Anhänger der antiautoritären Erziehung. „Meine Schüler sollen selbstbestimmt handeln“, lautete seine Devise. In der Benotung von Klassenarbeiten sah er ein Repressionsinstrument. Deshalb lagen seine Noten grundsätzlich zwischen „Sehr gut“ und „Ausreichend“. Niemals „Mangelhaft“ oder „Ungenügend“.
Eine Fehde mit der Bürgermeisterin
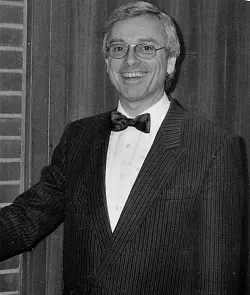
Friedrich Mahlmann schilderte, wie er frischen Wind in den Schulalltag bringen wollte. Als er aber bei seiner ersten Konferenz darum bat, als Schulleiter einige Klassenarbeiten vorgelegt zu bekommen, „ging ein Sturm der Entrüstung durch die Reihen“. Weil er seinen Kollegen offenbar nicht vertraue. Zuche und Lausbach argumentierten am lautesten, schreibt er. Nach über drei Stunden Konferenz gab der Schulleiter frustriert auf: „Es war, als wolle man mit Erleuchteten über das Licht diskutieren.“
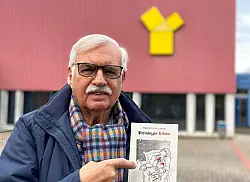
Auch der Kleinstadt Rodenburg hielt Mahlmann den Spiegel der Satire vor. Dem Kegelklub „Bullenkopf“ zum Beispiel, in den er durch seinen Präsidenten, den Apotheker Ellmann-Budweg eingeführt wurde. „Getrunken wurde rundenweise und in zügigem Tempo“, schreibt Mahlmann. „Bevor die Gläser aber zum Mund geführt wurden, wünschte sich der jeweilige Rundengeber ein Lied aus der Schatztruhe des Lordliedgutbewahreres.“ Offenbar volltrunken verlor der Schulleiter auf dem Nachhauseweg seine Brille. Amüsant schildert Autor Friedrich Mahlmann auch seine Fehde mit der Bürgermeisterin Dr. Gesine Matzrath. Der Dauerstreit mit ihr eskalierte, als von ihr an einem Sonntagmorgen ein Mitarbeiter in „geheimer Mission“ ins Gymnasium geschickt wurde, um das elektronische Inventar zu überprüfen. Denn der Schulleiter hatte zuvor zwei neue Computer beantragt.
Aber der Wirbel um „Pestalozzis Erben“ erwies sich als beste Werbung für das Buch im Jahre 1997. Vor allem in den regionalen Buchhandlungen sprang Mahlmanns Werk auf Platz eins der Bestsellerliste. Die erste Auflage war im Nu vergriffen. Zwei Lehrer allerdings fühlten sich durch die Satire in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt, weil sie sich in den Figuren des Buches wiedererkannt glaubten. Schon das Oberlandesgericht Hamm jedoch wies die Klage der beiden Oerlinghauser Pädagogen ab. Ebenso der Bundesgerichtshof. Doch sie ließen nicht locker. Letztlich klärte nach mehreren Jahren das Bundesverfassungsgericht unwiderruflich zugunsten Friedrich Mahlmanns den Fall. Die „Kunstfreiheit“ des Buches sei höher zu bewerten als die reine Vermutung, dass man sich in den Romanfiguren zu erkennen glaube. Die Satire hatte gesiegt.








