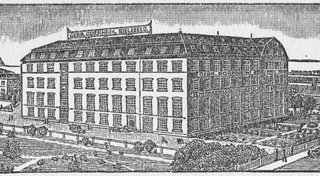Schieder-Schwalenberg. Es ist ein Gebäude mit Geschichte: Das mehr als 400 Jahre alte und denkmalgeschützte Fachwerkhaus in der Marktstraße 5 in der Schwalenberger Altstadt. Heute ist dort der Kunstverein mit seinen Ausstellungen und Veranstaltungen beheimatet. Einst war das Haus 200 Jahre im Privatbesitz der jüdischen Familie Bachrach, die den Novemberpogromen im Jahr 1938 zum Opfer fiel. Fünf Stolpersteine vor der heutigen Galerie Haus Bachrach sollen künftig an die Familie und das Leid, das sie erfahren musste, erinnern.
"Die Aufarbeitung der Geschichte hat in Schwalenberg schon vor einigen Jahren begonnen", erzählt Bürgermeister Jörg Bierwirth. Nachdem sich der Rat im Jahr 2015 einstimmig für das Projekt "Stolperstein" ausgesprochen hatte, nahm sich der Jugendkreis Schieder des Themas an. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen recherchierten, unter anderem im Bundesarchiv Gedenkbuch, über das Leben der einzelnen Mitglieder der Familie Bachrach. "Dazu gab es eine tolle Ausstellung", erinnert sich das Stadtoberhaupt.
Aktion vor der Galerie im Dezember
Nachdem die damalige Leiterin Linda Hermanns-Janßen den Jugendkreis verließ, ruhte das Projekt einige Jahre, bis sich vor einigen Monaten eine neue Projektgruppe gründete. "Die Gruppe wurde vom Kunstverein angeregt, ist aber institutionsunabhängig", erklärt Annegret Kulms, die zu dem engagierten Kreis gehört. Vor Kurzem hat die Arbeitsgruppe dann die freudige Nachricht erhalten: Der Berliner Künstler Gunter Demnig wird am 7. Dezember ab 13 Uhr fünf Stolpersteine vor der Galerie Haus Bachrach verlegen.
Die Gedenktafeln aus Messing werden an Gustav, Fränze, Heinz und Hildegard Bachrach sowie an Willi Harf erinnern. Die Familie Bachrach hatte im Jahr 1700 ein Handelsgeschäft in Schwalenberg gegründet. Bis in die 1930er versorgte es Kunden mit Manufaktur-, Mode- und Eisenwaren sowie Landesprodukten. Die Familie Bachrach war eine der wenigen, die auch nach der NS-Machtübernahme 1933 in Schwalenberg geblieben war und die Ausgrenzung der Juden durch die NS-Behörden hautnah miterlebte.
Geschäft und Wohnhaus verwüstet
Den Recherchen des Jugendkreises Schieder zufolge wurde Gustav Samson Bachrach am 19. Juli 1875 geboren. Er war das siebte von insgesamt neun Kindern. Sechs seiner Geschwister verstarben schon früh, sodass er als ältester Sohn das Familiengeschäft übernahm. Mit seiner Frau Emmy (geb. Krohn) hatte er drei Kinder. Nach dem Tod seiner Frau heiratete er Fränze Landsberg.
Das Geschäft und das Wohnhaus der Familie Bachrach wurden am 9. November 1938 gewaltsam geöffnet, durchsucht und verwüstet. Die Familie wurde ihrer persönlichen Gegenstände beraubt. Gustav Bachrach und ein Handlungsgehilfe wurden in Schutzhaft genommen und nach Blomberg deportiert. Nachdem er neun Tage im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert war, musste Gustav Bachrach sein Geschäft an die Stadt übertragen. Daraufhin floh er zu seiner Schwester nach Hannover. Am 15. Dezember 1941 wurde Gustav Bachrach in das Ghetto in Riga (Lettland) deportiert. Dort oder im Konzentrationslager Stutthof (Polen) wurde er ermordet. Die Daten seien hier widersprüchlich, wie die Jugendlichen bei ihrer Recherche feststellten.
Über Fränze Bachrach fand der Jugendkreis heraus, dass sie am 17. August 1896 in Bochum als Fränze Wolfstein geboren wurde. Aus ihrer ersten Ehe mit Ludwig Landsberg ging ein Sohn hervor. Nachdem sie im Juli 1940 von ihrem ersten Ehemann geschieden wurde, heiratete sie den verwitweten Gustav Bachrach. Am 9. August 1944 wurde Fränze Bachrach im KZ Stutthof ermordet.
Sohn kann zunächst entkommen
Eine weitere Gedenktafel wird an Heinz Bachrach, dem ersten Kind von Gustav und Emmy Bachrach, erinnern. Er führte mit seinem Vater das Familiengeschäft in Schwalenberg. In der Pogromnacht konnte Heinz Bachrach seinen Verfolgern entkommen und tauchte erst später in Hannover bei seiner Familie wieder auf. Gemeinsam mit seinem Vater und weiteren Familienmitgliedern wurde er in das Ghetto in Riga deportiert. Knapp zweieinhalb Jahre später, am 1. April 1944, wurde er in das KZ Stutthof gebracht und dort ermordet. Nach Angaben des Jugendkreises ist sein Todesdatum nicht bekannt. Gleiches gilt für Heinz Bachrachs Ehefrau, die am 14. November 1907 als Hildegard Moses geboren wurde. Sie wurde ebenfalls in das Ghetto Riga und das KZ Stutthof deportiert.
Der fünfte Stolperstein wird Willi Harf, dem Lehrling von Gustav Bachrach, gewidmet. Er wurde am 4. Juli 1917 in Sarstedt geboren. Willi Harf war vom 26. bis zum 31. März 1942 in Hannover inhaftiert. Am 1. April 1942 wurde er in das Warschauer Ghetto deportiert. "Wann Willi Harf ermordet wurde und ob er noch lebend im Warschauer Ghetto angekommen ist, ist nicht bekannt", hielten die Jugendlichen in ihrer Präsentation damals fest.
Nachfahren gesucht
Die Schwalenberger Projektgruppe wird sich nun um alle Vorbereitungen rund um die Verlegung der Stolpersteine kümmern. So werde unter anderem ein entsprechendes Rahmenprogramm erarbeitet, wie Annegret Kulms erklärt. "Wir bemühen uns auch außerordentlich, herauszufinden, ob es irgendwo noch Angehörige der Familie gibt." Wer diesbezüglich Hinweise hat, solle sich an den Kunstverein wenden. Ebenso könne die Arbeit mit Spenden unterstützt werden.